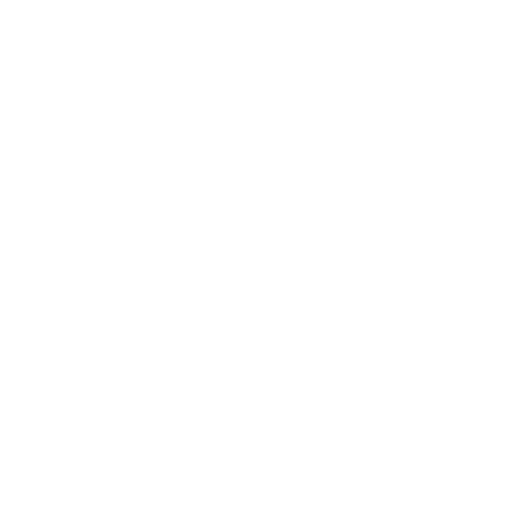Liebe Freunde Kants und Königsbergs, liebe Kaliningrader,
es ist mir eine große Ehre, heute hier für ein leider verhindertes Vereinsmitglied, dass eigentlich die Bohne beim letzten Erinnerungsmahl fand, die berühmte Bohnenrede zu halten.
Seit meiner Zusage begleiteten mich zahlreiche und natürlich wohlmeinende Ratschläge, die mir deutlich machten, dass die Erwartungshaltung an diese Tischrede groß ist und inhaltlich offensichtlich schwankt zwischen einer kurzen Einführung in Kants philosophisches Werk in einer halben Stunde oder einer anderen großen philosophischen Darstellung zwischen Leibniz, Schopenhauer und Feuerbach in der gebotenen Kürze. Natürlich gab es auch den freundlichen Rat, auf keinen Fall über etwas Philosophisches zu sprechen, da dies auf Kants Tischgesellschaften nicht üblich war. Und: Eine launische Rede sollte ich auch auf keinen Fall halten, gab man mir als weitere Ermunterung mit auf den Weg.
Was also tun, fragte ich mich mit immer größerer Verunsicherung, vor allem als jemand, der selbst beruflich eher ein Generalist ist und bisher noch nie über Kant gearbeitet und gesprochen hat. Letztendlich entschied ich mich, auch in Hinblick auf meine Potsdamer Herkunft, über Kant selbst und die Berliner Aufklärung zu sprechen und dabei in den Mittelpunkt meiner Rede ein Potsdamer Ereignis zustellen, das einen engen Brieffreund Kants betraf – Moses Mendelssohn. An einem einzigen Tag des Jahres 1771 kam es fast zu einem direkten Kontakt Mendelssohns mit dem „Philosophen von Sanssouci“ in Potsdam. Warum und wieso sie sich dann doch nicht trafen, soll die Kerngeschichte meiner Rede sein. Aber nun alles der Reihe nach:
Zunächst einige Worte zu Kant und seinen legendären Mittagstafeln, ein für mich noch neues Thema, für Sie hoffentlich eine nicht zu bekannte Geschichte. Viele seiner Biografen, deren Bücher eher eine Einführung in das Kantsche Werk sind[1], verweisen bei der Schilderung über Kants Alltag und seiner Person auf das Erinnerungsbuch[2] von Ehregott Andreas Wasianski (1755-1831), einem Königsberger Theologen, der zum späten Vertrauten Kants wurde. Für mich wurde dieses Buch ebenfalls der Zugang zum Menschen Kant und seinen Tischgesellschaften, über die er selbst in seiner „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“ verallgemeinernd schrieb:
„Das Wohlleben, was zu der letzteren noch am besten zu stimmen scheint, ist eine gute Mahlzeit in guter (und wenn es sein kann auch abwechselnder) Gesellschaft; … Allein zu essen … ist für einen philosophierenden Gelehrten ungesund, … Der genießende Mensch, der im Denken während der einsamen Mahlzeiten an sich selbst zehrt, verliert allmählich die Munterkeit, die er dagegen gewinnt, wenn ein Tischgenosse ihm durch seine abwechselnde Einfälle neuen Stoff zur Belebung darbietet; welchen er selbst nicht hat aufspüren dürfen“.[3]
Ebenso wichtig war mir, auf alten Stadtplänen Königsbergs zu schauen, wo denn nun genau das Kantsche Haus gestanden hat, in das der Philosoph seine Gäste regelmäßig einlud und wo er aus einem der Fenster auf den Löbenichter Kirchturm sehen konnte.
Ohne abschweifen zu wollen, sei hierzu die wunderbare Geschichte vom Nachbarn erzählt, dessen Pappeln Kant bald die Sicht nahmen, und er, der Nachbar, sie zu Ehren des großen Philosophen kürzen ließ, damit seine Sicht wieder frei war. Ob nun tatsächlich so geschehen, oder ob die Geschichte nur von Wasianski gut erfunden war, sie zeigt die große Verehrung, die Kant schon zu Lebzeiten entgegengebracht wurde.
Vom Autor der Erinnerungen an Kant erfahren wir auch etwas vom Ablauf der Tischgesellschaften, bei denen, was ich besonders interessant fand, über Vorfälle in der Stadt Königsberg nur gesprochen wurde, wenn sie außergewöhnlich waren. Fast nie, unter den Kantkennern ist das natürlich bekannt, wurde über philosophische Fragen gesprochen. Dafür drehten sich die Gespräche um Fragen der Naturwissenschaften, der Politik und in den Jahren der sogenannten Koalitionskriege gegen das revolutionäre Frankreich auch um militärische Fragen von Strategie und Taktik.
Die aktuellen Themen der mittäglichen Gesprächsrunden stammten meistens aus der Zeitung, besonders aus der in Königsberg zur Berühmtheit gelangten „Hartungschen Zeitung“, die zu Kants Lebzeiten noch „Königlich privilegierte preußische Staats- Kriegs- und Friedenszeitung“ hieß. Kants Diener Martin Lampe, von dem er sich erst 1802 trennte, hatte die Zeitung zweimal in der Woche zu holen. Nie soll sich Lampe den Namen der Zeitung gemerkt haben. Er nannte sie jedes Mal wieder, trotz Kants Ermahnung, „Hartmannsche Zeitung“.
Nun will ich mich natürlich nicht in weiteren Drolligkeiten zu Kants Alltagsleben verlieren, zumal vieles Ihnen wohlbekannt sein wird und ich befürchten muss, wie man sprichwörtlich so schön sagt, hier „Eulen nach Athen zu tragen“.
Deswegen lassen sie uns einen Sprung nach Potsdam machen zum „Philosophen von Sanssouci“. Auf ihn, den preußischen König, komme ich zu sprechen, aber es wird keine Würdigung seiner Werke und seiner Tafelrunde, sondern erinnern will ich an einen Berliner Aufklärer, der seit 1763 zu den dauernden Brieffreunden Kants gehörte und der sich an einem einzigen Tag seines Lebens auf Befehl Friedrich des Großen nach Potsdam aufmachte: der schon in meiner Einleitung erwähnte Moses Mendelssohn.
Mendelssohn kam 1743 als vierzehnjähriger Talmudschüler aus Dessau nach Berlin. Er lernte mit Eifer zunächst ganz in der jüdischen Bildungstradition. Erst als Hauslehrer beim Berliner Seidenfabrikanten Isaak Bernhard, dessen späterer Teilhaber er wurde, lernte Mendelssohn Deutsch, Latein, Französisch und Englisch im Selbststudium, las die deutschen und englischen Aufklärer. Lessing, der Mendelssohn 1754 in den Kreis der Berliner Aufklärer einführte, beschrieb ihn in einem Brief:
„Er ist wirklich ein Jude, ein Mensch von etlichen zwanzig Jahren, welcher ohne alle Anweisung, in Sprachen, in der Mathematik, in der Weltweisheit, in der Poesie eine große Stärke erlangt hat. Ich sehe ihn im Voraus als eine Ehre seiner Nation an, wenn ihn anders seine eignen Glaubensgenossen zur Reife kommen lassen, die allezeit ein unglücklicher Verfolgungsgeist wider Leute seinesgleichen getrieben hat. Seine Redlichkeit und sein philosophischer Geist lässt mich ihn im Voraus als einen zweiten Spinoza betrachten, dem zur völligen Gleichheit mit dem ersten nichts als seine Irrtümer fehlen werden“.[4]
1763 gewann Mendelssohn die Preisfrage der Akademie der Wissenschaften mit der Schrift „Über die Evidenz in metaphysischen Wissenschaften“ vor Kant, der den zweiten Preis erhielt. Daraus entstand ein dauerhafter freundschaftlicher Briefwechsel der beiden Philosophen. Mendelsohn war darüber hinaus eng befreundet mit dem Arzt und Philosophen Marcus Herz (1747-1803), einem Schüler Kants. Seine Frau Henriette führte einen der berühmten Berliner Salons.
Hierzu ein Briefzitat aus der Zeit, als Kant ordentlicher Professor für Logik und Metaphysik an der Königsberger Universität wurde. Am ersten Weihnachtstag 1770 schrieb Mendelssohn an Kant:
Hochedelgebohrner Herr! Insonders Hochzuehrender Herr Professor!
Herr Marcus Herz der sich durch Ihren Unterricht, und, wie er mich selbst versichert, noch mehr durch Ihren weisen Umgang, zum Weltweisen gebildet hat, fährt rühmlich auf der Laufbahn fort, die er unter Ihren Augen zu betreten angefangen. So viel meine Freundschaft zu seinem guten Fortkommen beytragen kan, wird ihm nicht entstehen. Ich liebe ihn aufrichtig, und habe das Vergnügen fast täglich seines sehr unterhaltenden Umgangs zu genießen. Es ist wahr, die Natur hat viel für ihn gethan. Er besitzet einen hellen Verstand, ein weiches Herz, eine gemäßigte Einbildungskrafft, und eine gewisse Subtiligkeit des Geistes, die der Nation natürlich zu seyn scheinet. Allein welch ein Glük für ihn, daß eben dise Naturgaben so frühzeitig den Weg zum Wahren und Guten geführt worden sind. Wie mancher, der dises Glük nicht gehabt hat, ist in dem unermeßlichen Raume von Warheit und Irrthum sich selbst überlassen geblieben, und hat seine edle Zeit und seine besten Kräffte, durch hundert vergebliche Versuche, verzehren müssen, dergestalt daß ihm am Ende beides Zeit und Kräffte fehlen, auf dem Wege fortzufahren, den er, nach langem Herumtappen, endlich gefunden hat.
Hätte ich vor meinem zwanzigsten Jahre einen Kant zum Freunde gehabt!
Ihre Dissertation habe ich mit der größten Begierde in die Hande genommen, und mit recht vielem Vergnügen durchgelesen, ob ich gleich seit Iahr und Tag, wegen meines mehr geschwächten Nervensystems, kaum im Stande bin, etwas spekulatives von diesem Werthe, mit gehöriger Anstrengung durch zu denken. Man siehet, dise kleine Schrift ist die Frucht von sehr langen
Meditationen, und muß als ein Theil eines ganzen Lehrgebäudes angesehen werden, das dem Verf. eigen ist, und wovon er vor der Hand nur einige Proben Hat zeigen wollen.[5]
1771 sollte Mendelssohn auf Antrag des Schweizer Theologen und Philosophen Johann Georg Sulzer (1720-1779) in die königliche Akademie der Wissenschaften aufgenommen werden, was am Widerstand des Königs scheiterte. Der „Philosoph von Sanssouci“ konnte hier nicht über seinen Schatten springen und wollte es einem der berühmtesten Juden seines Landes nicht gestatten, Mitglied der Akademie zu werden.
Umso überraschender war die plötzliche Einladung bzw.
Weisung Friedrichs vom September 1771 an Mendelssohn am 30. des Monats nach Potsdam zu kommen und auf dem Schlosse Sanssouci zu erscheinen. Dieses Handbillet an den „berühmten Juden Moses“ kam an einem Freitag an. Der 30. September 1771 war der darauffolgende Montag, an dem Mendelssohn nach Potsdam reiste. Er tat dies mit einer rabbinischen Genehmigung, nicht wie man annahm, weil er am Sabbat reisen wollte, sondern weil an diesem Tag nach dem jüdischen Kalender ein Feiertag war: Schemini Azeret, dass Schlussfest, das unmittelbar auf das siebentägige Laubhüttenfest folgt.
Als Mendelssohn in Potsdam am Berliner Tor ankam, meldete er sich beim wachhabenden Offizier, dessen Name überliefert ist: Carl Ludwig von Knebel (17441834). Dieser war vollkommen überrascht, den von ihm so verehrten Mendelssohn leibhaftig vor sich zu sehen. Beide waren befreundet und trafen sich öfters in einem Berliner Café. Knebel hatte unter den dichtungs- und bildungsempfänglichen Potsdamer Gardeoffizieren einen Kreis der Aufklärung gebildet, sozusagen einen militärischen Musenhof in der unmittelbaren Umgebung Friedrich des Großen, ohne dass dieser selbst den Offizierskreis wahrnahm. Was Knebel über den König in jenen späten Lebensjahren als „Alter Fritz“ niederschrieb, klang auch deswegen wenig schmeichelhaft:
„Ich habe die Jahre 1763 bis 1773 unter Friedrich den Großen in Potsdam zugebracht, und lebte, wie andere Offiziere, in dumpfer Bewunderung und Furcht vor dem König. … Der König wurde eigentlich von Niemand geliebt, als von denen seiner Unterthanen, den er Wohlthaten erwiesen, und die ihn nicht kannten. Die Uebrigen fürchteten ihn meistens und Furcht und Liebe vereinigen sich schwerlich zusammen.“[6]
Und so war es auch nicht Friedrich selbst, der Moses Mendelssohn in Potsdam sprechen wollte, sondern sein Gast, der sächsische Staatsmann Thomas Freiherr von Fritsch (1700-1775). Dieser hatte am 15. Februar 1763 als sächsischer Unterhändler den Frieden von Hubertusburg unterzeichnet und war deshalb dem preußischen König durch die damaligen Verhandlungen wohlbekannt und vertraut.
Fritsch, Sohn eines bekannten Leipziger Verlagsbuchhändlers und später geadelt, erwarb sich in den Jahren des Friedens nach 1763 große Verdienste beim Wiederaufbau Sachsens. Bis ins hohe Alter nahm er Anteil am Wirken Mendelssohn für die Berliner Aufklärung.
Knapp vier Jahre nach seinem Potsdamer Treffen bat Fritsch noch Friedrich Nicolai, einem weiteren großen Vertreter der Berliner Aufklärung, um eine neue Veröffentlichung Mendelssohns, die in Sachsen nicht zu bekommen war.
Aber nun zurück zu diesem 30. September 1771. An diesem Tag fanden im Schloss Sanssouci zwei Treffen zwischen Fritsch und Mendelssohn statt. Eines vor und eines nach der Mittagstafel. Die Einzelheiten der Gespräche sind nicht überliefert, aber es ist zumindest zu vermuten, dass sich der König von Fritsch über seinen Dialog mit Mendelssohn vor der Mittagstafel hat unterrichten lassen. Man kann auch davon ausgehen, dass Friedrich die drei Werke Mendelssohn, die auch auf Französisch vorlagen, kannte. Auf der zweiten, nachmittäglichen Unterredung, Mendelssohn hatte so lange zu warten gehabt, soll Fritsch bei aller Bewunderung für das philosophische Werk Mendelssohn, ihn gefragt haben, warum er immer noch an seinem Judentum festhalte und sich nicht zum Christentum bekehren lässt. Daraufhin soll er geantwortet haben: „…, was soll ich creditieren dem Sohn, … (da) der Vater noch lebt?“.[7]
Es ist nicht bekannt, ob Friedrich unter anderen Umständen womöglich genauso gerne wie seine jüngere Schwester Luise Ulrike (1720-1782), die Königinwitwe Schwedens, mit Mendelssohn ins Gespräch gekommen wäre. Diese hatte sich nämlich nur wenige Monate nach der hier geschilderten Potsdamer Episode am 7. Januar 1772 gegenüber ihrem Schweizer Vorleser Jean Francois Beylon (17171779) geäußert: „Der berühmte Jude Mendelson hat mich besucht und wir waren 2 ½ Stunden zusammen. Ich gestehe Ihnen, es erschien mir wie nur eine Minute. Das ist ein seltener Mensch mit einer Klarheit im Ausdruck, wie man ihn kaum findet unter den Metaphysikern“.[8]
Der Potsdamer Besuch [9]Mendelssohns endete aber, wie wir wissen, ohne ein Gespräch zwischen dem König und seinem Philosophen, der als Jude nicht zu „den Göttern auf den Olymp der königlichen Akademie der Wissenschaften und der schönen Künste“9 geladen wurde.
Mendelssohn hat sich trotz all‘ solcher Erlebnisse „sein Vertrauen in hilfreiche Freunde, in den preußischen aufgeklärten Absolutismus, in die Macht der Vernunft und Humanität“[10] nie ernstlich erschüttern lassen. Nach Potsdam ist er nie wieder gekommen. „Auch im Berlin jener Jahre war es gewiß nicht immer eine Lust zu leben; (so können wir es in einer vor dreißig Jahren erschienen Abhandlung über die Berliner Aufklärung lesen) aber hier noch am wenigstens bildeten die Alltagserfahrungen einen Einspruch gegen die Vorstellung von einem allmählichen, doch gesicherten geistigen, zivilisatorischen Fortschritt. Wenn Mendelssohn ihm nicht geheure Abweichungen von der mittleren Linie bürgerlichen Glaubens und Meinens wahrnahm, entschloß er sich, sie zu übersehen.“[11] Mendelssohn starb 1786, im selben Jahr wie sein König, am Ausklang der großen Epoche der europäischen Aufklärung.
Lassen Sie mich mit einem Auszug aus einem acht Jahre vorher geschriebenen Brief Kants an Mendelssohn enden, der noch einmal zeigt, welche große Wertschätzung die beiden Philosophen füreinander zeigten. Der in dem Brief erwähnte Dank an den Minister bezieht sich auf ein Angebot des Ministers und Großkanzlers Karl Abraham v. Zedlitz (1731-1793), Kant auf Empfehlung Mendelssohns eine Professur an der Universität Halle anzubieten. Kant schlug vor allem aus gesundheitlichen Gründen die Offerte aus, trotzdem Zedlitz im März 1778 das angebotene Jahresgehalt noch von 600 auf 800 Reichstaler erhöhte.[12] In dem Brief an Mendelssohn heißt es:
Verehrungswürdiger Freund
Mit dem größesten Vergnügen ergreife ich diese Gelegenheit, wenn es auch nur in der Absicht wäre, Ihnen meine Hochachtung und den herzlichen Wunsch zu bezeigen, daß Sie in dem Genusse einer mit fröhlichem Herzen verbundenen Gesundheit eines Lebens genießen mögen, an dessen zurükgelegten Theil Sie mit Zufriedenheit sich zu erinnern so viel Ursache haben. Mein Gesundheitszustand, den ich nur durch eine gewisse Gleichformigkeit der Lebensart und der Gemüthsbeschäftigung erhalten kan, hat es mir unmöglich gemacht, der guten Meinung des verehrungswürdigen Ministers von mir (woran Sie wie ich glaube einen vorzüglichen Antheil haben) mich folgsam zu bezeigen und dadurch Gelegenheit zu bekommen, Ihnen und Herren Herz persöhnlich meine Ergebenheit zu beweisen, welches ich ietzt und künftig nur schriftlich thun kan als meines höchstschätzbaren Freundes – Koenigsberg ergebenster treuer Diener
I.Kant, Koenigsberg d. 13. July. 1778. [13]
Mit einem Zitat des römischen Dichters Horaz, dass Kant so sehr gefallen haben soll, wünsche ich uns allen eine gute Mahlzeit im Angedenken an den großen Philosophen und Königsberger:
„Wenn’s zur Zeit schlecht läuft, wird es nicht auch in der Zukunft so sein“[14]
[1] z. B.: Höffe, Otfried, Immanuel Kant, München 2014
[2] Immanuel Kant in seinen letzten Lebensjahren. Ein Beytrag zur Kenntniß seines Charakters und häuslichen Lebens aus dem täglichen Umgang mit ihm, von E. A. Ch. Wasianski, Diakonus bei der Tragheimschen Kirche in Königsberg, Königsberg, 1804
[3] Immanuel Kant Werkausgabe XII, Immanuel Kant, Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik, suhrkamp taschenbuch wissenschaft 193, Frankfurt 1977, Seite 617-620
[4] Zitiert nach: Hermsdorf, Klaus, Literarisches Leben in Berlin, Aufklärer und Romantiker, Berlin 1987, Seite 93
[5] Kant, AA X: Briefwechsel Band I, 1747-1788: https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/aa10/113.html (Zugriff 13.3.2017)
[6] Strauß, Bruno, Moses Mendelssohn in Potsdam am 30. September 1771, Mit einem Essay von Eva J. Engel, herausgegeben von Julius H. Schoeps und Hermann Simon, Berlin 1994, Seite 70
[7] Strauß, Bruno, a.a.O., Seite 78
[8] Strauß, Bruno, a.a.O., Seite 79-80
[9] Strauß, Bruno, a.a.O., Seite 80
[10] Hermsdorf, Klaus, a.a.O., Seite 98
[11] ebenda
[12] Kant, AA X: Briefwechsel Band I, 1747-1788: https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/aa10/228.html (Zugriff 17.3.2017)
[13] Kant, AA X: Briefwechsel Band I, 1747-1788: https://korpora.zim.uni–duisburg–essen.de/kant/aa10/233.html (Zugriff 17.3.2017)
[14] Immanuel Kant in seinen letzten Lebensjahren., a.a.O., Seite 107