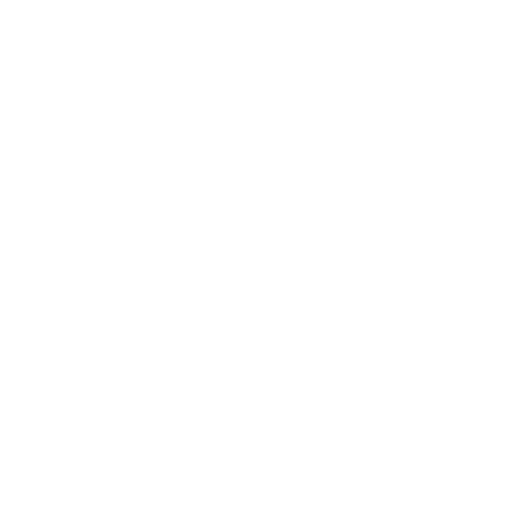A. Kants Friedensschrift wird gern zu den ausschließlich moralisch motivierten „Friedensrufen“ gerechnet, die davon ausgehen, dass letztlich, trotz aller Widrigkeiten der politischen Welt, der Frieden siegen muss, den sich jeder gutwillige Mensch nur wünschen kann. Daran ist richtig, dass Kant starke moralische Gründe hat, die Menschheit in der eigenen, wie auch in der Person eines jeden anderen zu wahren. Es sind Gründe, die letztlich jeden Menschen dazu verpflichten, seinesgleichen mit Achtung zu begegnen und sich um friedliche Verständigung zu bemühen. Gesetzt, daran würde sich jeder halten, brauchte man keinen Krieg.
Die Folge könnte nur ein „ewiger Frieden“ sein. Dabei ist zu bedenken, dass Kant mit dem Wörtchen „ewig“, keinen Anspruch auf eine wörtlich verstandene Ewigkeit erhebt.[1] Er verlangt lediglich, dass der Frieden ernsthaft gewollt und ohne Vorbehalt und ohne Hintergedanken geschlossen wird. Man könnte auch, mit einem von Kant geschätzten Attribut, vom kategorischen Frieden sprechen. Für ihn wird keineswegs nur mit moralischen Gründen argumentiert; vielmehr trägt Kant eine politische Konzeption des Friedens vor, die auf die 1795 bestehende geschichtliche Lage, auf den gegebenen ökonomischen und technischen Entwicklungsstand, sowie, erstmals in einer philosophischen Abhandlung überhaupt, auf die globale politische Organisation aller Menschen bezogen ist.
Kant spricht, lange vor der atomaren Hochrüstung, von den „höllischen Waffen“, die erwarten lassen, dass die Menschheit schon in absehbarer Zeit „auf dem großen Kirchhofe der Menschengattung“ (8, 374) ihr Ende findet. Also ist ein dauerhafter Frieden schon deshalb unerlässlich ist, weil ohne ihn die Menschheit gar nicht fortbestehen kann. Dabei kann man ergänzen, dass sich der kategorische Frieden gewiss nicht ohne die moralisch gefestigte und politisch gesicherte
Überzeugung erreichen wird, danss eine friedliche Verständigung mit allen Menschen anzustreben ist.
Deshalb muss es auch nicht wundern, dass die Notwendigkeit moralischer Überzeugung im Hintergrund bleibt. Kant erwähnt sie zum Beispiel, wenn er die Verlogenheit der Staatsmänner aller Zeiten mit ätzender Kritik überzieht. Dabei steht außer Zweifel, dass man „moralische Politiker“ braucht, die bereit und in der Lage ist, das auch zu tun, was sie öffentlich versprechen.
Um Ethik und Moral geht es auch, wenn Kant vom Anspruch auf einen „ewigen“ Frieden spricht. „Ewig“ meint hier nicht, dass es um eine endlose Zeitspanne geht; das Attribut gewinnt überhaupt nur im Kontext einer praktisch-philosophischen Selbstbindung seinen Sinn. Und es bedeutet hier, dass der Mensch den Frieden aus ernsthaftem Selbstinteresse verfolgt – und zwar so, wie es der kategorische Imperativ verlangt: um die Menschheit bereits in seiner eigenen Person zu wahren. Dazu ist der moralische Selbstanspruch des Einzelnen unerlässlich – und der gilt „ewig“, weil wir es uns nicht erlauben können, uns zu irgend einem Zeitpunkt unseres gegenwärtigen – und vielleicht auch unsers „ewigen Lebens“ – in der Hoffnung auf „Unsterblichkeit“ – nicht vorstellen dürfen, irgendwann „unmoralisch“ zu sein.
Von diesem elementaren moralischen Anspruch ausgehend, verlangt Kant, dass Politik als „ausübende Rechtslehre“ zu verstehen ist, so dass in den im Vordergrund stehenden politischen und rechtlichen Bestimmungen nicht ausdrücklich von der Moral gesprochen werden muss.
Erst im Anhang der Friedensschrift rückt die Moral ausdrücklich ins Zentrum, wenn Kant seine unerhörte These vom inneren Konnex zwischen Öffentlichkeit und Moralität formuliert. Hier trägt er seine Einsicht vor, dass sich im politischen Raum Politik und Moral wechselseitig fordern. Die Öffentlichkeit verlangt sowohl vom einzelnen Bürger wie auch von seinen politischen Repräsentanten, glaubwürdig zu sein. Die Politik setzt auf die Verlässlichkeit eines gegebenen Worts.
Hier tritt der innere Zusammenhang zwischen Individuum und Menschheit hervor, auf den auch die Verbindung zwischen Moral und Recht gegründet ist; ohne sie könnte das Recht niemals die Legitimation haben könnte, Zwang von Menschen über Menschen ausüben zu können.
B. Der kleine Text Zum ewigen Frieden, in dem sich Kant im Alter von 71 Jahren erstmals ausdrücklich mit einem politischen Problem befasst, findet nur eine kurze Zeit Aufmerksamkeit – und das wohl auch nur bei jenen Lesern, die Kants Sympathie für die revolutionären Vorgänge in den Neuenglandstaaten und in Frankreich teilen. Andere sahen darin wohl eher einen Grund, die Friedensschrift als verfehlt anzusehen. So verliert sich schon wenige Jahre nach der Veröffentlichung das Interesse an Kants Überlegungen. Denn die Politik, mit der Napoleon zur selben Zeit damit beginnt, Europa mit Krieg zu überziehen, verlagert die Aufmerksamkeit vom Frieden auf den Krieg.[2]
So ist und bleibt es bei der überwiegenden Zahl der auf Kant folgenden Philosophen. Sie zeigen wenig Interesse an den „Friedensbewegungen“, die im 19. Jahrhundert, ähnlich wie die Frauen- und die Arbeiterbewegung öffentliche Aufmerksam finden. Diese „Friedensfreunde“ nennen sich nach einem Jahrhundert bereits weltumspannender Aktivität „Pazifisten“ – ein Begriff, der sich bis heute gehalten hat. Man möchte glauben, dass Kant in ihnen endlich die Leser gefunden hat, die seine Schrift Zum ewigen Frieden verstanden haben und nunmehr in politische Praxis umzusetzen suchen.
Das gilt für dem moralischen Appell des Pazifismus. Doch den politischen und rechtlichen Impuls, auf den sich Kants Aufmerksamkeit in seiner Friedensschrift konzentriert, verfehlt der Pazifismus vollkommen. Kants kleine Schrift ist keine Gründungsschrift der „Friedensbewegung“. Denn wofür er plädiert, entspringt einem aufgeklärtem, nüchternen und in allem auch realistischen Interesse an der Politik. Und sein kleines Buch bietet eine Theorie, die dazu beitragen kann, in einer wesentlich aus Gegensätzen, friedloser Konkurrenz und erbarmungsloser Antagonismen bestehenden Welt, gleichwohl einen rechtlich gesicherten, globalen Frieden zu ermöglichen, der den Menschen eine Zukunft eröffnet, die es jedem möglichen macht, selbstbestimmt zu leben.
Das wurde erstmals von einem amerikanischen Präsidenten verstanden, der vor seiner Amtszeit im Weißen Haus Rektor der Universität Princeton war und dort selbst in einer philosophische Lehrveranstaltung Kants Friedensschrift behandelt hatte. Aus dieser Lektüre bezog Woodrow Wilson den Vorschlag zu einem Völkerbund, in dem möglichst alle Staaten der Welt Sitz und Stimme haben sollten. Mit dieser Idee warb er 1919 auf der Friedenskonferenz zur Beendigung des 1. Weltkriegs in Versailles erfolgreich für einen Völkerbund.
Der Völkerbund wurde tatsächlich gegründet, erwies sich aber nach etwas mehr als einem Jahrzehnt als unfähig, auch nur der widerstreiten Interessen in Europa Herr zu werden. Der zweite Weltkrieg folgte, und in ihm nahm ein anderer amerikanischer Präsident, Delano Roosevelt, die Idee wieder auf, in deren Zeichen dann 1949 die Vereinten Nationen gegründet wurden. Nun folgte die Politik erstmals Immanuel Kant mit dem Versuch, alle Mitglieder auf das Menschenrecht zu verpflichten.[3] Die UNO konnte (wenigstens bis heute) einen 3. Weltkrieg verhindern.
Ob das noch lange möglich sein wird, muss man leider bezweifeln. Sicher ist, dass allein die vermittelnde Leistung der Organe der UNO, ihre Friedensmissionen, die Kontrolle der Verbreitung von Kernwaffen oder die (wenn auch noch unzureichend ausgebaute) internationale Gerichtsbarkeit nicht ausreichen, um den Weltfrieden zu sichern. Hier bedarf es einer grundlegenden Revision. Ob es den Vereinten Nationen, beim jetzigen Stand der Organisation, jedoch gelingt, eine in ihrem Bestand gefährdete Atommacht vom Einsatz ihrer Kernwaffen abzuhalten, ist durch nichts garantiert.
In den kenntlich gewordenen Schwächen der UNO liegt aber keine Widerlegung Kants. Im Gegenteil: Wäre man ihm entschiedener gefolgt, sähe die Welt anders aus. Allerdies ist heute vieles dazu gekommen, von dem Kant noch gar nichts ahnen konnte. Der heute offenkundige Bedarf an internationaler Kooperation und Kommunikation, die Sicherung des internationalen Verkehrs, der Gesundheits– und Katastrophenschutz, die zahllosen Maßnahmen zur Regulierung der Wirtschaft sowie die weltweite Koordinierung elementarer Rechte machen deutlich, dass nur eine Instanz in globaler Zuständigkeit, über die Kompetenz und die Autorität verfügen kann, die im Fall eines bedrohlichen Konflikts unerlässlich sind.[4] Und wer es heute für realistisch hält, an Stelle der einen UNO drei oder vier regionale Weltorganisationen zu stellen, weiß nicht, was es heißt, globale Kompetenz mit weltweiter Verantwortung zu verbinden, dem sei eine erneute Lektüre von Kants Friedensschrift empfohlen – wobei er auch erkennen kann, welche Vorzüge Kants Option für den Föderalismus hat.
C. Wenn man sich fragt, wie es Kant möglich war, als Autor, der nie zuvor politische Vorlesungen gehalten und keine politischen Abhandlungen geschrieben hat, im Alter von 71 Jahren sein erstes und einziges politisches Buch publiziert und damit auch nach 225 Jahren der Sache näher ist, als mancher Gegenwartsautor. Zur Erklärung kann ich nur darauf verweisen, dass Kant auch hier seiner transzendentalen Methode folgt, mit der er im Bereich des Erkennens, des moralischen und juridischen Handelns, des Urteilens über die Kunst, über das Leben oder die Religion revolutioniert hat. Und so verfährt er auch mit der Politik: Kant zerlegt sie in ihre begrifflichen Bestandteile und fügt sie so zusammen, wie es das Selbstverständnis des Menschen verlangt.
Und dabei weitet er den philosophischen Horizont, passt ihn der modernen Welterfahrung ab und trägt im Wesentlichen politische Überlegungen vor, die sich auf die zutage tretenden erweiterten Fähigkeit der Menschheit und ihre globale Reichweite beziehen. „Es ist so weit gekommen, dass die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen anderen gefühlt wird.“[5] Diese schlichte Bemerkung zeigt das an, was der modernen Lebensweise entspricht.
Nun geht es um einen neuen Staatsbegriff sowie um die Fundierung der Politik durch das Menschenrecht, um die Auszeichnung eines jeden Menschen als Weltbürger, der überall gleiche Grundrechte genießt, und um die Öffnung der Republik für die Regierungsform der Demokratie.
Alle diese Forderungen sind Elemente einer Theorie der Politik, deren Pointe zwar darin besteht, dass sie vom einzelnen Menschen nur ernstgenommen werden können, wenn sich jeder selbst als moralische Person versteht. Aber zu handeln hat er unter den Bedingungen der Politik und damit in den Schranken des Rechts! Für diese Einsicht kann die Friedensschrift als Ganze stehen. Um dies zu zeigen, beschränke ich mich im Folgenden in zehn Punkten darauf, das Genialische dieses
Textes zu illustrieren.[6]
1. Ein konkreter politischer Anlass. Die in kürzester Zeit geschriebene Gelegenheitsschrift erschien wenige Monate nach dem im April 1795 in Basel erzielten Friedensschluss der beiden großen Monarchien in der Mitte Europas, Preußen und Habsburg–Österreich, mit der aus der Revolution hervorgegangenen Französischen Republik. Es war nicht nur der Friedensschluss als solcher, der Kant motivierte, sondern gewiss auch die Anerkennung einer Form der Verfassung, die seit Jahrhunderten verächtlich gemacht und als Widersacher der Monarchie schlechthin bekämpft worden war. Für Kant bestand das Unerhörte der in Basel erzielten Vereinbarung darin, dass zwei Königreiche bereit waren, ihrem Gegner (einer Republik, die erst zwei Jahre zuvor, im Januar 1793 den König hingerichtet hatte!), die Hand zu reichen und Frieden zu schließen.
Kant war Untertan des preußischen Königs. Er hatte schon die Unabhängigkeitsbestrebungen der englischen Kolonien in Amerika unterstützt, hatte deren Trennung von der englischen Krone befürwortet und die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika begrüßt. Mit Blick auf die nachfolgenden Vorgänge in Paris hatte er die Argumente der Vertreter des Dritten Standes in Königsberg selbst so vernehmlich vertreten, dass seine Freunde fürchteten, der Preußische König könne ihn seines Amtes als Professor entheben.
Vor diesem Hintergrund liegt Kant nicht an einem moralischen „Friedensruf“, so groß und bedeutend dessen Tradition im Geist des neuzeitlichen Humanismus auch ist. Es ist vielmehr der aktuelle politische Horizont, in dem Kant seine Argumentation entwickelt. In ihm kann er es sich erlauben, nicht den moralischen Appell in den Vordergrund zu stellen, sondern sich durchgängig mit elementaren Fragen der Organisation des Politischen zu befassen. Es sind vornehmlich die aus den Prämissen der Freiheit und Gleichheit erwachsenen, von Kant in einen globalen menschenrechtlichen und uneingeschränkt öffentlichen Rahmen gestellten politiktheoretischen Fragen, die den Philosophen, trotz der mehr als 200 Jahre, die seit der Publikation des Büchleins vergangen sind, immer noch wie einen Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts erscheinen lassen.
2. Ein neues Staatsverständnis. Kant hat eine an Nüchternheit gar nicht zu überbietende Sicht auf den Staat: Der Staat ist die Einheit, in der eine Gemeinschaft von Menschen über sich selbst verfügt. Ihre zentrale Aufgabe liegt in der politischen Selbstbestimmung einer Menge von Menschen. Das geht aus seiner – eher beiläufig an den Anfang gestellten – Definition des Staates hervor: Ein Staat, „ist eine Gesellschaft von Menschen, über die Niemand anders, als er selbst zu gebieten und zu disponiren hat“ (8, 344).[7]
Hier wird die politische Selbstbestimmung aller Bürger zum Definiens des Staates. Damit sind sämtliche Ansprüche auf den Vorrang einer Klasse von Menschen, eines herrschenden Geschlechts oder eines Autokraten, so groß deren Überlegenheit auch sein mag, null und nichtig. Wenn Kant sich auf die „Idee des ursprünglichen Vertrages“ beruft (8, 344), dann unterstellt er, dass jeder Einzelne als gleichberechtigter Staatsbürger Träger der staatlichen Vereinigung ist. Er ist dies als Person und als mündiges Glied einer Gemeinschaft, die in ihrer Gesamtheit über die Ordnung, die Zielsetzung und die Bestimmung des Staates nach von ihr mehrheitlich in ihrer Gesamtheit selbst beschlossenen Gesetzen befindet.
Das muss man auch deshalb hervorheben, weil Kants kleine Schrift bis heute mit dem Missverständnis verbunden ist, hier werde nur ein „süßer Traum“ (8, 343) geträumt, der bestenfalls moralische Bedeutung haben könne. Diesen Traum zu träumen ist jedem unbenommen. Und seine moralische Verantwortung hat der Einzelne allemal, unabhängig davon, ob er sich als Privatperson oder als Bürger begreift. Aber im Vollzug der staatlichen Selbstverwaltung kommt es darauf an, dass alle Entscheidungen mit der mehrheitlichen Zustimmung aller gefällt und in der arbeitsteiligen Gemeinschaft aller ausgeführt werden.
So impliziert die Staatsdefinition Kants bereits den Modus ihres praktischen Vollzugs. Nur eine Gemeinschaft, die allen ihren Mitgliedern gleiche Rechte und Pflichten einräumt und auferlegt, genügt dem Verständnis eines Staates, wie Kant ihn zum Regelfall einer kommenden Weltordnung erklärt, in der „Frieden ohne Vorbehalt“ (8, 344) herrschen kann.
3. Ein sozio-politischer Blick auf Krieg und Frieden. Kant geht vom dichten Zusammenhang vieler gesellschaftlicher Aktivitäten mit dem Kriegsgeschehen aus; er versucht, dem in seiner Beschreibung der Ausgangslage des politischen Handelns Rechnung zu tragen. Das gilt insbesondere angesichts der immer dichter werdenden wirtschaftlichen und finanziellen Verflechtungen, die sich aus der letztlich unvermeidlich werdenden weltweiten Kooperation ergeben. Dabei ist dem Autor klar, dass die Kreditwirtschaft bereits mit ihrer Entstehung eine wesentliche Größe ist, die es den Politikern leicht macht, Kriege zu führen. Deshalb schlägt er vor, Kriegsanleihen grundsätzlich zu verbieten. Die „Geldmacht“, so schreibt er, sei das „zuverlässsigste Kriegswerkzeug“ (8, 345) überhaupt.
Im Gegenzug spricht er sich dafür aus, den zwischenstaatlichen Handel zu fördern. Ein für alle Beteiligten vorteilhafter Handel, so seine Annahme, vermindere die Neigung zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Das aber gilt, wie wir heute genauer wissen, nur unter Bedingung verlässlicher wechselseitiger Rechtsbeziehungen der Staaten untereinander. Auf sie legt Kant dann auch den denkbar größten Wert. Dabei ist er davon überzeugt, dass es Rechtssicherheit nur geben kann, wo den Menschen gleiche Grundrechte zugesichert sind.
4. Die rechtliche Fundierung der Politik. Kants Ausführungen zur Wahrung der republikanischen Prinzipien und der universellen Geltung des Weltbürgerrechts sind das Rückgrat seiner Friedenstheorie. Sie erlauben ihm seine Kritik am Kolonialismus, am Rassismus und an der Sklaverei (8, 358). Dabei wird unterstellt, dass die finanziellen und ökonomischen Aktivitäten von elementarer politischer Bedeutung sind. Ihre Regelung kann aber nur erfolgreich sein, wenn zugleich die Rechte eines jeden Einzelnen überall gelten und universell geachtet werden. Also geben nach den Präliminarartikeln die drei Definitivartikel der Friedensschrift zu erkennen, auf welche Gründe sich Kants nachfolgendes Plädoyer für den Föderalismus der Staaten stützt.
Ein originäres Moment seiner Diagnose ist Kants Warnung vor der Eigenlogik der Rüstung. Die Rede vom Friedhof, von der er bereits in der an die Staatsoberhäupter gerichteten Vorrede Gebrauch macht und auf die ja schon der Titel Zum ewigen Frieden anspielt, nimmt in der Folge die Form einer realen Zukunftsperspektive an. So spricht Kant vom politischen „Despotism“, der die Menschheit auf den „großen Kirchhof der Menschengattung“ bringen kann, auf dem alle ihr vorzeitiges Ende finden (8, 347 u. 367). Zwei Jahre später, wenn er der menschlichen Gattung als ganzer ein vorzeitiges Ende vorhersagt (und damit deutlich macht, dass er alles andere als einen unbedenklichen Zukunftsoptimismus vertritt), sieht er die Gefahr, dass die Menschheit früher als gedacht zugrunde geht, sollten die Staatsoberhäupter weiterhin ihre wesentliche Aufgabe darin sehen, ihre Untertanen in den Kriegen zu „schlachten“. [8]
In der Friedensschrift hat Kant seine frühere These abgeschwächt, dass Kriege die Fähigkeiten der Menschen so herausfordern, dass ein Volk der Menschheit ein Beispiel an Mut, Ehrbewusstsein und Standhaftigkeit geben kann.[9] Diese Tugenden will er dem Einzelnen auch hier gewiss nicht absprechen; nun aber betont er, dass der Krieg dem Leben entgegensteht, weil er den Menschen die Freiheit raubt, während der Frieden den „lebhaftesten Wetteifer“ der Menschen ermöglicht und damit die Entfaltung ihrer Produktivität begünstigt (8, 367). Mit der unablässigen Verbesserung der Waffen droht der Krieg überdies, zu einer Gefährdung aller Menschen zu führen und so zu einem „Ausrottungskrieg“ zu werden, der in absehbarer Zeit keine Menschen mehr am Leben lässt (8, 347). Mit der hundertfünfzig Jahre später erfolgenden Erfindung der Atomwaffen ist offenkundig geworden, dass Kant nicht übertrieben hat.
5. Die Prinzipien der Politik. Die tragenden Säulen einer republikanischen Staatsverfassung: Freiheit, Gleichheit und Abhängigkeit, werden in der politischen Theorie bis heute als Selbstverständlichkeit angesehen und angemessen betont, so schwer ihre Begründung auch fallen mag. In der 1785, also zehn Jahre vor der Friedensschrift erschienen Grundlegung zur Metaphysik der Sitten hat Kant die Freiheit als „Autonomie“ und „Selbstbestimmung“ definiert, wobei ihm das philosophische Kunststück gelungen ist, sie mit der Gesetzlichkeit zu verbinden und sie damit zugleich von dem Verdacht zu befreien, sie äußere sich allein in der Willkür eines einzelnen Menschen. Die recht verstandene Freiheit liegt vielmehr in der Selbstbestimmung eines jeden! Damit ist die Freiheit einer Person als eben das zu verstehen, was bei jeder anderen Person auch vorausgesetzt werden muss. Also ist die Gleichheit eine wesentliche Implikation der Freiheit eines jeden, die folglich auch jedem anderen zugestanden werden muss.
Mit der Gleichheit im Bewusstsein der Freiheit eines jeden anderen kommt es notwendig zu dem in der Mitte stehenden drittem Definitivartikel: Das ist die Abhängigkeit (8, 349 f.) – die „rechtliche Abhängigkeit“, wie Kant eigens hervorhebt. Sie findet erst in ihrer rechtlichen Vermittlung von Freiheit und Gleichheit zu ihrer politischen Relevanz. In der Natur ist Abhängigkeit die durchgängige Realität, und in der Gesellschaft besteht sie keineswegs nur in den ersten Lebensjahren oder im hohen Alter. Alle eigenen, aber auch alle auf andere Menschen gerichteten Bedürfnisse beruhen auf Abhängigkeiten und sie schaffen weitere, die damit in der Regel auch gewollt und nicht selten sogar gewünscht werden. Hier bereits kündigt sich der befremdlich erscheinende Zusammenhang von Freiheit und Abhängigkeit an. Aber sobald wir sehen, dass Abhängigkeit auch entsteht, wenn Menschen durch ihre eigene freie Entscheidung für ein alle verpflichtendes rechtswirksames Gesetz votieren, verschwindet dieser Widerspruch!
Die in ihrer Verbindung mit der Freiheit und der Gleichheit verstandene Abhängigkeit kann damit als Alleinstellungsmerkmal der Politik verstanden werden. Die Natur macht den Menschen durch günstige Lebensbedingungen, aber eben auch in Kriegen und in Naturkatastrophen, seine Abhängigkeit von ihr bewusst. Diese Bindung stellt die Politik unter die Prämissen der Freiheit und Gleichheit und vergegenwärtigt den Menschen, die nur in Gesellschaft leben können, welchen Bewegungsspielraum sie gegenüber der Natur haben – ohne ihnen die Chance zu eröffnen, sich jemals gänzlich von ihr befreien zu können. So wie die Gemeinschaft schon Ausdruck der Tatsache ist, dass der Mensch (so wie er sich durchschnittlich versteht) nicht allein leben kann, macht ihm das (zwischen Freiheit und Gleichheit stehende) Prinzip der Abhängigkeit bewusst, dass er aufgrund seiner freien Zustimmung auf seinesgleichen angewiesen ist und bleibt.
6. Die Wende zur Demokratie. Die politische Reichweite des Prinzips der Abhängigkeit tritt darin hervor, dass sie es ist, die Kant zum möglichen Befürworter der Demokratie werden lässt, obgleich er in der Friedensschrift noch erklärt, dass die Demokratie zwangsläufig zum „Despotism“ führe! Doch die republikanischen Prinzipien der Freiheit, der Gleichheit und der gegenseitigen Abhängigkeit machen zusammen mit dem Anspruch auf eine egalitäre Repräsentation aller Bürger, lassen Kant gar keine andere Wahl als die Demokratie. Zwei Jahre später, also 1797, in der Rechtslehre seiner Metaphysik der Sitten argumentiert er kompromisslos für die [10]Demokratie. 10 Denn nun plädiert er dafür, dass auch eine demokratische Regierungsform „republikanisch“ genannt werden könne.[11] Damit darf Kant als einer der ersten gelten, der im deutschen Sprachraum als Anwalt der Demokratie aufgetreten ist.
Das geht so weit, dass er die französische „Revolution“ in ihrem juridischen Kern als Votum für die Demokratie versteht. Denn Kant begründet, warum es als ein Rechtsbruch angesehen werden muss, wenn ein demokratisch konstituiertes Parlament die höchste Macht wieder in die Hände einer einzelnen Person, einer Klasse oder einer Partei zurückzugeben suchte. In einem zur gleichen Zeit verfassten Text[12] vertritt Kant die Auffassung, die Französische Revolution dürfe im strengen Sinn gar nicht als „Revolution“ bezeichnet werden; sie müsse vielmehr als „Evolution“, ja, als vom Staatsoberhaupt angestoßene „Reform“ begriffen werden! Doch 1792 habe der französische König die drei Jahre zuvor aus den Händen gegebene Macht wieder zurückverlangt. Also habe er als ein das Recht verletzender „Revolutionär“ zu gelten.
Damit hat Kant die Demokratie als innere Konsequenz dessen definiert, was den Staat ausmacht: nämlich eine „Gesellschaft von Menschen“, „über die niemand anders als er selbst zu gebieten und zu disponiren hat“ (8, 344). Dafür spricht auch alles, was bereits in der Friedensschrift zugunsten der Reform und gegen die Revolution zu finden ist. In alledem wird klar, dass Kant von der Gleichheit aller Bürger ausgeht, wobei er auch die Frauen einbezieht. Er weckt mit keinem Wort den Eindruck, die republikanischen Prinzipien könnten nur auf die Männer beschränkt sein. Allein mit Blick auf die Theorie hätte Kant schon in der Friedensschrift als Anwalt der Demokratie auftreten können. Wenn er diesen Schritt 1795 noch nicht getan hat, so dürfte das daran liegen, dass er, Rousseau folgend, noch annahm, die Demokratie sei letztlich nicht mit dem Prinzip der Repräsentation vereinbar. Nachdem er aber durch die verheißungsvollen ersten Jahre parlamentarischer Praxis in Frankreich und in Amerika, den Eindruck haben konnte, dass sich in Demokratien auch mit einfachen Mehrheiten regieren lässt, hatte er allen Grund für die Demokratie einzutreten.
7. Föderation als globales Prinzip. Zu den fortwirkenden Innovationen der Friedensschrift gehört die Exposition der Föderalität als grundlegendes Prinzip der internationalen Politik. Die Originalität Kants liegt darin, dass er die Föderation als zunächst nur viele, letztlich aber alle Staaten vertraglich verbindendes Element souveräner Staaten versteht. Er tastet die Eigenständigkeit der Staaten nicht an, bindet sie aber durch ein Netzwerk wirtschaftlicher und rechtlicher Verbindung zusammen, auf das sie aus Eigeninteresse und zunehmend auch aus Gründen ihrer eigenen Rechtssicherheit nicht verzichten können. Für ihn besteht der erste Schritt in der gemeinsamen Friedenswahrung, mit dem Willen, Kriege unter einander zu vermeiden. Für die Föderation wäre es schon ein Erfolg, wenn sie zwischen den europäischen Staaten eine der Verständigung dienende Verbindung schaffen.
Wie weitsichtig, aber eben auch höchst anspruchsvoll Kants Vorschlag war und ist, wird augenblicklich klar, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass Europa schon damals der größte bellizistische Unruheherd der Erde war – und bis heute geblieben ist. Kants Kritik am Kolonialismus, den es gewiss schon in früheren Epochen gegeben hat, aber zu seiner Zeit wesentlich von Europa ausging, führt vor Augen, wie richtig es war, diesen Erdteil, also Europa, ins Zentrum der föderalen Bestrebungen zu rücken.
Dabei darf man nicht übersehen, dass Kant Europa nicht zum Vorbild für den Rest der Welt erklärt. Zwar kann man nicht leugnen, dass die leitenden Ideen der Aufklärung, der Demokratie und des Menschenrechts ihren Ursprung in Europa haben. Aber Kant ist bewusst, dass die Europäer fortwährend dabei sind, die von ihnen propagierten großen Ideen zu verraten. Die Europäer sind es, die sich an der großen Tradition, aus der sie kommen, vergehen. Sie widerlegen sich durch ihre kolonialen Verbrechen selbst und richten sich durch ihre Maßlosigkeit in Krieg und Frieden selbst zugrunde (8, 359 f.).
8. Menschenrecht. Kant ist mit dem Prinzip des Menschenrechts jeder Abstufung menschlicher Grundrechte entgegengetreten. Seine Überzeugung vom Unrecht, das Menschen anderen Menschen antun, wenn sie Sklaverei billigen, Rassismus für gerechtfertigt halten oder Kolonien zulassen, ist nicht bloß auf Mitgefühl gegründete Anteilnahme am Schicksal anderer. Es ist vielmehr eine durch Argumente gesicherte ethische Position, wie sie vor Kant noch von keinem anderen Denker entwickelt und dem Recht zugrunde gelegt worden ist.
Die immer wieder geführte Diskussion, ob Kant seine Friedenskonzeption auf ein moralisches oder auf ein rechtliches Fundament stützt, erübrigt sich, weil er ja schon das Recht auf Prämissen stellt, die gleichermaßen moralisch wie juridisch sind. So ist der Begriff der Person in beiden Geltungssphären unverzichtbar. Er zeichnet die Identität des jeweils handelnden Menschen aus und setzt voraus, dass er über eigene Einsichten und eigene Urteilskraft verfügt, die nicht ausschließen, dass er über eine Vielfalt von Fähigkeiten und Leistungen gebietet. Auch die Identität einer Person ist kein monolithischer Block im individuellen Bewusstsein. Das „Ich“ sagende und alle epistemischen, ethischen, ästhetischen und religiösen Leistungen begleitende „Selbst“ wird von Kant als „vielfärbig“ apostrophiert, und kann, vielleicht sogar deshalb, unter dem Anspruch stehen, sich immer auch als Repräsentant der „Menschheit“ zu begreifen.
Für diese zur Natur des Menschen gehörende Komplexität gehört auch, dass der Mensch sich sowohl als moralisches wie auch als justiziables, als rechtfähiges Wesen zu verstehen hat. Der Unterschied zwischen Moral und Recht liegt nicht im Individuum, hängt also nicht vom Belieben des einzelnen Menschen ab. Es geht, nach Kant, um eine Differenz in der „Art der Gesetzgebung“, die im Recht äußerlich ist und erzwungen werden kann, in der Moral hingegen nur dem eigenen Urteil unterliegt, dessen Konsequenzen jeder ganz allein zu ziehen hat.
Kant stützt sich dabei weder auf vorgegebene Naturrechts-Traditionen noch auf eine religiöse Überlieferung. Er setzt mit seiner Begründung beim Selbstverständnis des Menschen an, das jeder voraussetzen muss, der von der Gewissheit ausgeht, selbst ein ernst zu nehmendes und wahrheitsfähiges Wesen zu sein, das damit Grund hat, von seinesgleichen anerkannt zu werden. Wer immer sich als Mensch unter Menschen begreift: Er spricht und handelt unter Ansprüchen, die ihn im Umgang mit seinesgleichen auf Bedingungen verpflichten, die er nicht missachten kann, ohne sich selbst preiszugeben.
Dieser für jeden Menschen geltende oberste moralische Grundsatz hat eine unmittelbare Folge für das Recht. Denn das Recht hat sein oberstes Prinzip in der Verpflichtung, die Bedingung dafür zu sichern, dass jeder Mensch seine Würde wahren und moralisch handeln kann. Dieses Prinzip ist die Freiheit. Und so formuliert Kant dieses „einzige“ Recht, das ihm als Person ursprünglich „angeboren“ ist, in einem Grundsatz, aus dem alle weiteren Rechte des Menschen folgen: „Freiheit (Unabhängigkeit von eines Anderen nöthigender Willkür), sofern sie mit jedes Anderen Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann, ist dieses einzige, ursprüngliche, jedem Menschen kraft seiner Menschheit zustehende Recht.“ (MS Rechtslehre, Einl., 6, 237)
Das muss man sich in dieser Ausführlichkeit gegenwärtig halten, um zu erkennen, dass vom „Menschenrecht“ bei Kant nicht erst in einer dem modernen Bewusstsein verpflichteten Ergänzung der Rechtslehre die Rede ist, sondern dass es für ihn um den Anfangsgrund aller systematischen Überlegungen zum Recht überhaupt geht. Das Recht ist ursprünglich Menschenrecht, und so dürfte verständlich sein, dass es schon in der Politik den Anfang darstellt und unverzichtbar bleibt. Und mit dem Menschenrecht schützt der Mensch in jedem einzelnen seiner Mitmenschen, die Konditionen, die es ihm ermöglichen, frei, eigenständig und verantwortlich zu sein.
9. Reform statt Revolution. Das Recht zu wahren, ist die Prämisse aller Politik, insbesondere wenn es um Aktivitäten geht, die auf eine grundsätzliche Verbesserung gesellschaftlicher Zustände zielen. Hier gibt es für Kant keine Alternative zum Verfahren der Reform. Revolutionen gehören entweder in den Bereich der Natur oder in die Sphäre bloßen Denkens. In der Natur finden wir sie vornehmlich in den kosmischen Kreisprozessen des Alls und deren vielfältigen Folgeerscheinungen auf der Erde. Der lateinische Ausdruck revolutio ist ursprünglich auf die „Umdrehung“ bezogen, wie sie Erde um ihre eigene Achse oder in der Umkreisung um die Sonne vollzieht. Sie kann dann auch auf die Fähigkeiten des menschlichen Geistes bezogen sein, den Wandel, die Umkehr oder das Gegenteil zu denken. Doch gerade bei einer im Denken oder Handeln vollzogenen Umkehr, hat es sich jeder Mensch zu verbieten, den Willen anderer zu missachten.
Eben das aber geschieht beim Einsatz einer das Recht brechenden politischer Gewalt. Deshalb verbietet sich die Revolution. Die Reform, zu der auch Verhandlungen ausgehandelte Zugeständnisse – also Kompromisse – ist das einzige mit Legitimität versehene Mittel politischen Handelns. Die Revolution ist ein Rückfall in den Krieg.
Im Blick auf die geschichtliche Entwicklung wie auch in der Beschreibung politscher Vorhaben bevorzugt Kant den Begriff der Evolution, den er bereits 1790 in seiner kritischen Theorie des Lebendigen verwendet. Hier ist er selbst an der Profilierung des Terminus beteiligt. Wenn es ihm um geschichtliche, von Menschen zu bewältigen Neuerungen geht, zieht er den Begriff der „Reform“ vor. Denn „Reform“ ist dem „Ideal des öffentlichen Rechts angemessen“. Nur hier könne auch von einer Verpflichtung zur Veränderung gesprochen werden (8, 373). Revolutionen hingegen erzeugen lediglich die Illusion einer Verbesserung und bergen vor allem die Gefahr „mehr für erlaubt“ zu halten, als das Recht zulässt (8, 372). Nur Reformen entsprechen dem Recht und können sogar als Pflicht begriffen werden, während Revolutionen den „Ruf der Natur“ lediglich „benutzen“; folglich können sie nichts von dem, was die Autorität eines auf freier Entscheidung beruhenden Gesetzes ausmacht, zustande bringen (8, 373).
Eben damit charakterisiert Kant die größte Gefahr, die von einer politischen Revolution selbst herausgefordert wird: Indem sie sich von allem löst, was den vormaligen Zustand zusammenhielt, hat sie gar nichts mehr, was sie orientieren oder disziplinieren könnte. Und was die unmittelbare Einsicht der Individuen nicht bewirkt, muss mit Gewalt durchgesetzt werden. Das ist der bereits 1795 vertraute Effekt, den wir aus der Geschichte der Revolutionen des 20. Jahrhunderts zur Genüge kennengelernt haben. Sie enden ausnahmslos im Terror.
10. Kant ist kein Pazifist. In zeitlichem Anschluss an die Veröffentlichung von Kants Friedensschrift und wesentlich unter dem Eindruck der nachrevolutionären Kriege (mit denen Napoleon zunächst nur seine Nachbarn überzog, die in der Folge aber noch zu den auslösenden Faktoren der Ersten Weltkriegs gehörten) entstanden in den Großstädten Europas und zunehmend auch in den USA zahlreiche Friedensbewegungen. Für sie gab und gibt es bis heute nahezu täglich neue Anlässe. Anfang des 20. Jahrhunderts kam für den Beweggrund dieser Bewegungen die Bezeichnung „Pazifismus“ in Umlauf. Es liegt nahe, dass der Autor einer Schrift Zum ewigen Frieden von Pazifisten für ihre Ziele in Anspruch genommen und sogar selbst als „Pazifist“ bezeichnet wird.
Das ist gewiss nicht ehrenrührig. Doch es dient der Klärung, darauf hinzuweisen, dass der so nachdrücklich für eine Politik des Friedens plädierende Immanuel Kant, kein „Pazifist“ gewesen ist! Er war zwar für einen Frieden „ohne Vorbehalt“, verstand darunter aber keinen Frieden um jeden Preis. „Ohne Vorbehalt“ steht für die Ermahnung Kants, in Friedensverhandlungen der Pflicht zur Wahrheit und zur Aufrichtigkeit zu folgen. Das heißt: Man darf keinen Frieden in der Erwartung abschließen, dass in absehbarer Zukunft der Zeitpunkt zu einem weiteren Waffengang günstiger ist, um den Feind später definitiv besiegen zu können.
Es ist richtig, Kant die ernst gemeinte Absicht zuzuschreiben, Kriege zu vermeiden und ihre Durchführung nicht durch Kredite, bereitstehende Heere, durch fortgesetzte Hochrüstung und erst recht nicht durch die Vortäuschung falscher Tatsachen zu erleichtern. In der Nachfolge der Klage des Friedens des Erasmus von Rotterdam gehört Kant zu den wirkungsmächtigsten philosophischen Anwälten des Friedens. Aber er sagt auch deutlich, was im Fall eines Angriffs eines Staates durch einen andern zu tun ist: Dann gibt es keinen prinzipiellen Grund, auf Gegenwehr zu verzichten. Es kann auch nicht als verwerflich gelten, einen Angreifer zurückzuschlagen und ihm, wenn möglich, eine Niederlage beizubringen.
Kant denkt als Mensch, dem es schlechterdings nicht untersagt werden kann, sich zu wehren, wenn er angegriffen wird. In seiner Rechtslehre gesteht er allen Menschen in Lebensgefahr ein „Notrecht“ zu, das es nicht zulässt, das Verhalten des Einzelnen nach allgemeinen Prinzipien zu bewerten (MS R 6, 235 f.). Das muss auch ein Staat in Anspruch nehmen können, der von einem anderen ohne vorausgehende eigene Kriegshandlungen überfallen wird.
Und wenn ein Krieg, aus welchen Gründen auch immer, zum Ausbruch gekommen ist, dann hat man das Verhalten der Kriegsparteien nach Kategorien des Völkerrechts zu bewerten. Dann gilt das Recht vor dem Krieg, im Krieg und nach dem Krieg (MS R 6, §§ 56 – 61; 346 – 351). Wenn in der Friedensschrift „Hugo Grotius, Pufendorf, Vattel u. a.m.“ als „leidige Tröster“ abgefertigt werden, dann meint Kant deren Beschränkung auf Maßgaben, die nur empfehlenden und keinen gesetzlich nötigenden Charakter haben (8, 355). Aber er die Disziplin des Völkerrechts, das gerade durch die genannten Autoren groß geworden ist, verwirft Kant keineswegs.
Mehr noch: In seiner nach der Friedenschrift publizierten Rechtslehre behandelt Kant das Völkerrecht mit großem Respekt und in der philosophisch gebotenen Ausführlichkeit als einen unverzichtbaren Bestandteil des Rechts (MS R §§ 54 – 61; 6, 344 ff.). Wäre das anders, ließe er zu, dass jeder einseitig in Gang gekommener Krieg zu einem generellen Verzicht auf das Rechts überhaupt führen müsste. Damit träte man einem Angreifer in einem rechtsfreien Raum entgegen. Das kann nicht im Interesse des Friedens sein. Wo kein Recht mehr gilt, kann es auch keinen Frieden geben; und ohne Frieden wird es sinnlos, von Menschheit und Menschlichkeit zu sprechen.
Gleichwohl kann der Hinweis auf das Völkerrecht nicht das einzige Wort zur Frage des Pazifismus sein. Was hier aus Kants Sicht zur allgemeinen Friedenssicherung zu sagen ist, finden wir in seinen Ausführungen zum Föderalismus. Hier zeigt sich auch, auf welche Weise er das Defizit beheben will, das er bei den Völkerrechtslehrern beklagt: Er beschränkt sich nicht darauf, den Staaten den Frieden anzuraten (und darauf zu hoffen, dass sie den guten Argumenten der Theoretiker folgen). Er schlägt einen „Vertrag der Völker“ vor, der sie zu einem „Bund“ vereint, in dem sie sich selbst rechtlich verpflichtet haben, Frieden zu halten (8, 356). Was Kant dem Verlangen der Pazifisten am nächsten bringt, ist, dass er vom föderalen „Vertrag der Völker“ die Verbindlichkeit eines Friedensvertrags verlangt, der nach Möglichkeit nicht nur „einen Krieg“, sondern der „alle Kriege“ beendigt (ebd.).
Das aber soll nicht nach Analogie zur Staatsgründung unter einer alle Menschen gleichermaßen zwingenden Zentralgewalt geschehen, sondern in einem auf der Freiheit eines jeden einzelnen Mitgliedsstaats beruhenden Vereinbarung, durch die sie sich wechselseitig mit derselben Verbindlichkeit, die der innerstaatlichen Gesetzgebung zukommt, zur Wahrung eines unverbrüchlichen Friedens mit allen anderen Staaten verpflichten. Der föderale Bund errichtet also keinen alle Menschen und Staaten umfassenden „Völkerstaat“, er findet vielmehr unter der „Idee einer Weltrepublik“ zusammen (8, 357), die allen Menschen und Staaten Freiheit und Gleichheit garantiert – unter Beachtung des sie verbindenden Prinzips wechselseitiger Abhängigkeit.
Hier wahrt Kant die Grundprinzipien der Republik (und der zu ihr gehörenden Demokratie) im Interesse der Freiheit und Gleichheit aller. Aber auch er kann den Vorwurf, wenn nicht des „leidigen Trösters“, so doch des bloßen „Moralisten“ und „Friedensapostels“ auf sich ziehen, weil er nicht bereit ist, für einen Weltstaat zu argumentieren, der den Frieden mit der gleichen Zwangsgewalt sichern kann, mit der im Inneren die Wahrung von Ruhe und Ordnung versprochen wird. In Kants Augen erscheint es als sicher, dass ein Weltstaat nur in Form einer Despotie errichtet werden könnte, in der die Freiheit als erstes verloren wäre. Und ob es in ihr jemals zu einem Frieden kommen kann, darf nach allem, was wir aus historischer Erfahrung von Staaten wissen, in denen es keine Freiheit gibt, bezweifelt werden. Sie mögen vielleicht sogar manches Gute erwarten lassen, doch solange die Freiheit des Denkens, Sprechens und Handelns fehlt, wird es auch keinen Frieden geben.
Hier also ist Kant bestimmt kein Autor, der nur den „süßen Traum“ vom Frieden „träumen“ möchte (8, 343). Er denkt in Anerkennung der politischen Realität und versucht ihr nicht nur in seiner schonungslosen Analyse der von Kriegen zerfurchten Geschichte gerecht zu werden. Auch sein eigener Entwurf zur globalen Schaffung und Sicherung des Friedens steht unter dem Anspruch, das tatsächlich Mögliche zu tun. Dabei geht er von der Möglichkeit aus, eine Gesellschaft durch Recht zu zivilisieren und ihr eine repräsentative republikanisch-demokratische Ordnung zu geben. Alles Weitere bedient sich der Mittel, die in seiner durch Wissenschaft, Technik und Welthandel geprägten Kultur bereits entwickelt sind. Und er geht davon aus, dass sich diese Kultur nur entfalten kann, wenn sie auf den Einsatz von Waffen verzichtet, die den Bestand der Menschheit als ganze gefährden. Wie ernst seine Rede von den „höllischen Künsten“ und vom „großen Kirchhofe der Menschengattung“ tatsächlich ist, können wir unter der atomaren Bedrohung der Gegenwart noch um einiges besser verstehen, als dies Kant möglich war. Aber die apokalyptische Gefahr, die mit dem modernen Krieg verbunden ist, hat er schon Ende des 18. Jhdt. gesehen.
[1] Das bestätigt Kant selbst dadurch, dass er bereits im ersten Abschnitt seines Textes, das Wörtchen „ewig“ als „redundant“ bezeichnet. Im physikalischen Zusammenhang fehlt dem Adjektiv „ewig“ sogar der Gegenstand. Also „gibt“ es die Ewigkeit, als Sachverhalt verstanden, gar nicht. Aber der Ausdruck hat eine religiöse und politisch-diplomatische Funktion, an die Kant hier nicht nur aus rhetorischen Gründen anschließt. Er schätzt in den Religionen der Welt das Potenzial zu einer friedlichen Verständigung der Menschen, weiß allerdings, dass ihr Dogmatismus genau das Gegenteil bewirken kann.
[2] Ich verweise nur auf Clausewitz, ***
[3] Obgleich man hier den islamischen Staaten einen Sonderstatus gewährte und ihnen die unbedingte Bindung an das Menschenrecht erlassen hat.
[4] Kant, ***.
[5] Kant, ***
[6] Ausführlicher in v. Verf.: Das Neue in Kants Theorie des Friedens, in: R. Leonhardt, Friedensethik in Kriegszeiten, Leipzig 2023; ferner: ders.: Kants Entwurf zum Ewigen Frieden, Darmstadt 1995, 20234.
[7] Ich zitiere unter Angabe der Seitenzahl von Bd. 8, der Akademie-Ausgabe der Werke Kants.
[8] Kant, Der Streit der Fakultäten, 7, 89.
[9] So 1790 in der Kritik der Urteilskraft § 28 (KU 5, 263). In der Friedensschrift kann er jedoch dem Krieg eine „innere Würde“ zuerkennen (6, 365), der die kämpfende Truppen auszuzeichnen vermag.
[10] , 341f.
[11] MS R § 52; 6, 341.
[12] Im Streit der Fakultäten, der unmittelbar nach Abschluss der Friedensschrift verfasst wurde.